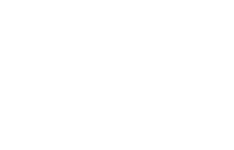Die Energiewende erreicht zunehmend auch deutsche Balkone: Immer mehr Menschen möchten mit sogenannten Balkonkraftwerken – kleinen Solaranlagen zur Eigenstromerzeugung – aktiv zur Energiewende beitragen. Besonders in Mietwohnungen oder Eigentümergemeinschaften stellt sich jedoch schnell die Frage: Was ist überhaupt erlaubt? Wer muss zustimmen? Und welche rechtlichen Grundlagen sind zu beachten?
Was sind Balkonkraftwerke?
Ein Balkonkraftwerk besteht in der Regel aus einem oder mehreren Solarmodulen sowie einem Wechselrichter, der den erzeugten Gleichstrom in haushaltsüblichen Wechselstrom umwandelt. Die Einspeisung erfolgt direkt über eine normale Steckdose – einfach, effektiv und zunehmend erlaubt.Gesetzliche Grundlagen – Das gilt ab 2024
Neue Leistungsgrenze:
Seit April 2024 dürfen Balkonkraftwerke bis zu 800 Watt über den Wechselrichter einspeisen, da die Grenze von 600 auf 800 Watt angehoben wurde. Diese Grenze lässt sich umgehen indem man überschüssige Energie in einem Batteriespeicher einspeist.
Anmeldung:
Eine Anmeldung des Balkonkraftwerks ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie muss im Marktstammdatenregister (MaStR) registriert werden. Dieses Vorgehen wurde durch das Solarpakt im April 2024 stark vereinfacht und beschränkt sich auf wenige, einfach einzugebende Daten. Eine Zusätzliche Anmeldung beim Netzbetreiber ist nicht mehr nötig. Die Bundesnetzagentur informiert diesen automatisch über das neue Balkonkraftwerk. Es gilt als Ordnungswidrigkeit, eine Anlage nicht anzumelden und die Bundesnetzagentur kann ein Bußgeld verhängen.
Stromzähler:
Digitale Zähler sind nicht verpflichten . Neue Balkon-Solaranlagen dürfen künftig auch dann genutzt werden, wenn noch kein digitaler Zweirichtungszähler installiert ist. Übergangsweise ist die Einspeisung über die alten analogen Ferraris-Zähler erlaubt. Diese drehen sich bei Stromüberschuss einfach rückwärts, was zu einer automatischen Reduzierung des gemessenen Stromverbrauchs führt. Das bringt einen direkten finanziellen Vorteil für die Verbraucherinnen und Verbraucher, denn sie zahlen dadurch weniger für zugekauften Netzstrom – ganz ohne zusätzlichen bürokratischen Aufwand.
Technik & Sicherheit
Künftig sollen Balkonkraftwerke auch mit einem Schukostecker betrieben werden dürfen – eine neue Norm ist in Arbeit. Dies soll die Installation noch einfacher machen.
Rechte der Mieter
Als Mieter ist man dazu verpflichtet sich vor der Installation einer Balkonsolaranlage an seinen Vermieter zu wenden und nach einer Genehmigung zu fragen. Allerdings besteht ein rechtlicher Anspruch auf die Genehmigung und darf vom Vermieter nur durch einen sachlichen Grund abgelehnt werden, beispielsweise bei unzureichender Statik des Balkons, oder einer erheblichen Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbilds. Der Vermieter darf aber über die Art und Weise der Befestigung mitbestimmen.
Rechte der Vermieter
Vermieter können Balkonkraftwerke nicht mehr pauschal ablehnen, sondern müssen triftige Gründe vorweisen können. Zudem haben sie Mitspracherecht bei der Anbringung, Art der Befestigung, der Optik oder bei technischen Spezifikationen. Vermieter können durch Wertsteigerung der Immobilie und ein umweltfreundliches Image profitieren.
Förderungen
Für den Kauf und die Installation von Balkonkraftwerken stehen verschiedene Förderprogramme sowie steuerliche Erleichterungen zur Verfügung. Unter anderem entfällt die Mehrwertsteuer auf die Anschaffung, was die Gesamtkosten der Investition deutlich reduziert.
Versicherungsschutz
Balkonkraftwerke sind nicht automatisch von Hausrat-& Haftpflichtversicherungen abgedeckt, weshalb sich vor der Installation unbedingt darüber informiert werden sollte ob Schäden am Gerät oder durch das Gerät abgesichert sind. Die zusätzlichen Kosten für den Versicherungsschutz sind meist überschaubar, da viele Versicherer mittlerweile spezielle Tarife für Steckersolargeräte anbieten.